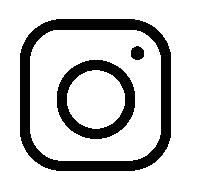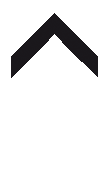Textbeispiele Journalismus
Weitere Textbeispiele finden Sie  hier
hier
Das Leben als Spiel
Eine große Spielfläche: Zwischen Klavier und Gitarre, vier Farben: Kirschrote Kissen hängen in einem Netz von der Decke und wollen einfach nicht hinunterfallen. Schweinchenrosa türmt sich ein Kissenberg auf, sonnengelb sind die Trainingsanzüge des vierköpfigen MOKS-Ensembles. Das sind unmissverständliche Verhältnisse für ein funktionierendes Kindertheaterstück.
„Wer bin ich? Bin ich weiblich? Bin ich rot? Bin ich ein gutes Kind? Bin ich echt? So lauten einige der forschenden Fragen um die eigene Identität in Antje Pfundtners „Ich Bin Nicht Du“. Eine der besonderen Gaben der mehrfach ausgezeichneten Choreografin ist es, aus den Menschen, mit denen sie arbeitet, ganz genau das herauszuholen, was sie ausmacht – so auch aus den vier Akteur*innen. In Pfundtners Sprache, den oft skurrilen Dialogen, den assoziativen szenischen Ideen und choreografischen Umsetzungen zeigt sich ihr Respekt gegenüber menschlicher Vielfältigkeit, die sie auf kluge wie witzige Weise einsetzt.
Kinder spüren schnell, ob sie ernst genommen werden. Tiefsinnig fragend wie feinsinnig humorvoll bannt die Inszenierung ihre Aufmerksamkeit. Ohne Kindertümelei bezieht sie das Publikum ein und verbindet Alltagserleben und Phantasie in Text, Spiel, Musik und Tanz. Ein kaum enden wollendes Suchen und Ausprobieren führt zu immer neuen Überraschungen mit Plüschwesen, goldenen Geheimnisträgerinnen und anderen Einzigartigkeiten.
Nah am Publikum entfaltet „Ich Bin Nicht Du“ eine eigene Magie und Lebensanschauung: Als Spiel betrachtet, bietet unser Dasein unendliche Möglichkeiten. Diesem Gedanken zu folgen, macht einfach Spaß!
Für ihre Produktion „Ich Bin Nicht Du“ im Jungen Theater/ MOKS in Bremen erhielt Antje Pfundtner den deutschen Theaterpreis 2020, DER FAUST, in der Sparte Kinder und Jugendtheater. Als Würdigung ihrer Arbeit erschien dieser Text in der Sonderbeilage von Die deutsche Bühne 11-2020
Mangel im Überfluss
„We feed the world“: Dokumentarfilm von Erwin Wagenhofer
„Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.“, sagt Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung. Denn wir haben genug Nahrung auf der Welt. Nach UN-Schätzungen könnte die Weltwirtschaft ohne Probleme 12 Milliarden Menschen ernähren. Doch warum gibt es dennoch so viel Hunger auf der Welt? Und wo bleiben die Massen von Nahrungsmitteln, die unsere hochtechnisierte Lebensmittelindustrie tagtäglich von den Fließbändern spukt?
Jeden Tag wird in Wien soviel Brot entsorgt, wie Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs täglich verbraucht. Die Berge von weggeworfenem Brot, die wir zu Anfang des Dokumentarfilms von Erwin Wagenhofer sehen, wirken fast zynisch. Von Anfang der Dreharbeiten an, haben den österreichischen Filmemacher vor allem die Zusammenhänge interessiert. Wo kommen die Nahrungsmittel her, die in unseren Geschäften liegen? Und warum legen sie oft tausende Kilometer zurück, wenn wir viele genauso gut beim Bauern nebenan erstehen könnten?
Um seine Fragen zu beantworten, fing Wagenhofer bei den Tomaten an, die aus dem 3000 Kilometer entfernten Südspanien zu uns gekarrt werden. Dort stieß er auf neue Fragen, die er sich wiederum an anderen Plätzen der Welt beantwortete. So machen wir uns mit dem Filmteam auf die Spur unserer Nahrungsmittel: Von Österreich nach Spanien, von dort in den brasilianischen Regenwald, weiter zu den französischen Fischern und zu den Bauern nach Rumänien. In eindrucksvollen Bildern bekommen wir Einblick in die Produktion von Gemüse bis hin zur Hähnchenbrust, die aus Stallungen mit 35.000 bis 70.000 Tieren stammt. Zusammen mit den Gesprächen mit Bauern, Fernfahrern, Fischern, bis hin zum Konzernchef von Nestlé International, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt, erhalten wir erste Antworten auf die Frage, was der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat.
Seit den 60er Jahren hat sich in Almeria die größte Gewächshausanlage der Welt entwickelt. Die Tomaten, die hier wachsen haben nie Erde gesehen. In Steinwolle gezogen, werden ihnen die Mineralstoffe mit einem Substrat zugefügt. Die Anlage braucht seit Jahrzehnten soviel Wasser, dass ganz Spanien mittlerweile große Probleme mit der Trinkwasserversorgung hat.
Geerntet wird das Gemüse von Afrikanern, oft Senegalesen. Sie leben in Spanien oder Frankreich, oft unter unmenschlichen Bedingungen. In ihrem eigenen Land müssten sie verhungern, unter anderem deshalb, weil europäisches Gemüse auf ihren Märkten nur für ein Drittel des Preises von einheimischem Gemüse verkauft wird. Das hat die meisten senegalesischen Bauern in den Ruin geführt.
Ebenso schlimm sieht es in Brasilien aus. Hier wird 90 Prozent des Sojas angebaut, das Europa für die Tiermast benötigt – damit wir jeden Tag, für ein Schnäppchen, eine große Portion „Gammelfleisch“ auf dem Teller haben. Dafür wird der Regenwald gerodet und die brasilianischen Kinder trinken pestizidverseuchtes Wasser und müssen hungern.
So wird in den südlichen Regionen der Welt die Landwirtschaft zerstört, während die reichen Länder ihren Bauern täglich mehr als 1 Millionen Dollar an Subventionen zahlen für Produkte, die wir schon im Überfluss haben. Die Lebensmittelkonzerne nennen das Gewinnoptimierung. „Die Konzerne haben kein Herz.“, sagt Karl Otrok, Produktionsleiter von Pioneer, dem weltgrößten Saatguthersteller. „Wir lassen die Armen sterben, damit es uns gut geht.“
Filmemacher Erwin Wagenhofer glaubt daran, dass wir alle etwas ändern können. „Wir sind alle KonsumentInnen.“ sagt er. „Wir gehen in Supermärkte und wir können bestimmen, was wir kaufen. Das ist eine Macht.“
Sein Film appelliert an unser Gewissen und unsere Verantwortung, ohne je plump den pädagogischen Zeigefinger zu heben. Seine geschickt montierten Bilder und Gesprächsauschnitte sprechen für sich.
So steht auch die Aussage von Nestlé-Chef Peter Brabeck am Ende ganz für seine Weltsicht, die nicht mehr bedeutet als Profit um jeden Preis. „We feed the world“ ist ein nachhaltig kluger Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
Martina Burandt, veröffentlicht im Weser Kurier 04-2006
Ja, renn nur nach dem Glück
„Will happiness find me?“ am Theater Bremen
Mit ihrem neuen Stück begeben sich Samir Akika und und seine Tanzcomagnie Unusual Symptoms auf Glückssuche. Dabei bewegen sie sich durch all die Trugbilder und Sehnsüchte vom sogenannten gelungenen Leben – was immer damit gemeint sein mag.
„Vielleicht ist die Frage (nach dem Glück) nicht, wie wir daran arbeiten können, unseren Existenzen Sinn zu verleihen, sondern wo wir stehen müssen, damit uns das Glück beim Vorbeiziehen erwischt.“ Das fragt sich Samir Akika in seiner neuen Choreografie. Doch schließt das eine das andere nicht aus: Denn in dem Moment, in dem wir herausgefunden haben, wo und wie wir im Leben am besten stehen, haben wir oft auch ein Gefühl für die Sinnhaftigkeit unserer Existenz gefunden.
„Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.“ Das hat Bertolt Brecht in seinem Lied von der Unzulänglichkeit so ähnlich ausgedrückt. Und schon geht es auf der Bühne los mit der „Rennerei“. Ein wenig wie ein verrückter Traum mutet all das wild überzogene, sonderbare, oft skurrile Treiben zunächst an. Doch schon bald erkennt man, dass alles Bemühen, Kämpfen und Tun alltäglicher ist, als man zuerst denken würde.
„I'm walking on the stars“ hört man gleich zu Anfang im wiederkehrenden Song, während dazu ein großes Gummibärchen in die heruntergekommene Vorgarten-Idylle (Bühne: Karl Rummel) tänzelt. Nach und nach folgen sieben weitere Ensemblemitglieder: manche bunt stilisiert wie aus Comics, andere ganz alltäglich gekleidet (Kostüme: Greta Bolzoni). Ein Pärchen wühlt in einem Sperrmüllberg, ein weiteres schlägt sich, jagt sich, schreit jauchzend. Jemand tanzt allein oder schaukelt in einem alten Autoreifen. Einer springt während eines Tanzsolos eine Kletterwand hoch, während am Boden ein anderer mit einem Staubsauger ringt. Drei stehen herum und lassen sich lange Nudeln aus den weit geöffneten Mündern ziehen. Mit Raumspray wird dem Leben ein glücklicherer Duft übergesprüht. Rote Plastikeimer und bunte Strumpfhosen kommen zum Einsatz und plötzlich wabert der Kunstrasen wie ein großes Organ zu psychedelischen Klängen.
Den Rhythmus gibt – wie so oft in den Choreografien Akikas – der Komponist und Performer jayrope an, diesmal zusammen mit der Musikerin und Performerin Suetzsu. Die Musik in „Will happiness find me“ ist hervorragend. Hoch oben über dem Geschehen hantiert das Musikerduo vor der Kulisse einer großen weißen Wolke mit Instrumenten und Stimme.
Dieser Tanzabend ist so überbordend abwechslungsreich und flüchtig wie das Glück. Geschickt bringt Samir Akika die gleichzeitig stattfindenden Szenen in einen Fluss. Die unterschiedlichen Themen und Darstellungsweisen – von Tanz über Schauspiel und Performance – ergeben ein flirrend lebendiges Ganzes. Gut sind auch die so unterschiedlichen Charaktere des neu zusammengestellten Ensembles in Szene gesetzt. Eineinhalb Stunden folgt das Publikum seiner bis ins Manische getriebenen Glückssuche, die schließlich unausweichlich ins Scheitern umschlägt. Was am Ende bleibt, ist eine Bilderflut, die Gefühle freisetzt, so unterschiedlich und flüchtig wie das Leben selbst. „Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug“, heißt es bei Brecht weiter passend, „drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug.“
Martina Burandt, veröffentlicht am 26.03.2019, in www.tanznetz.de – das tanzmagazin im internet